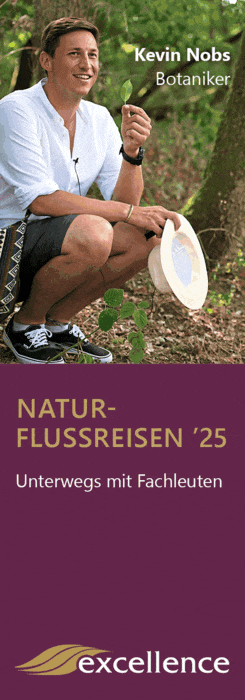Sie leben in Tümpeln, Weihern und Seen, aber auch an Land. Feuchtgebiete sind für sie überlebenswichtig. Doch die werden immer seltenerund mit ihnen unsere Frösche und Kröten.
Das ganze Jahr sind sie unter uns, aber meistens nehmen wir sie nicht wahr. Erst wenndie Temperaturen wieder steigen, wachen unsere heimischen Frösche und Kröten aus der Winterruhe auf. In der Schweiz leben 20 Amphibienarten in unseren Flach- und Hochmooren, Tümpeln, Seen oder Bächen und führen ein Doppelleben. Wer meint, sie leben mehrheitlich im Wasser, irrt sich, denn während eines grossen Teils ihres Lebens sind sie an Land.


Alle verbringen das Larvenstadium im Wasser und als ausgewachsene Tiere leben sie in nahe gelegenen Waldrändern oder Hecken. Zur Paarungszeit zieht es sie aber wieder zurück in die Gewässer. Seit 1966 sind die Amphibien (so nennt man Tiere, die sowohl im Wasser als auch an Land leben) geschützt. Auch deren Lebensräume, und trotzdem nimmt die Anzahl der Tiere ab. 14 der 20 Amphibien arten sind stark bedroht und stehen auf der roten Liste der gefährdeten Amphibienarten in der Schweiz.


Die Frösche und Kröten haben ein gefährliches Leben
Im Spätwinter (Januar bis Februar) werden die Froscharten wie der Grasfrosch, die Erdkröte oder der Springfrosch aktiv, andere wie die Kreuzkröte oder der Wasserfrosch erst im April/Mai. Eines haben sie aber gemeinsam, es zieht sie zum Laichplatz, der zielstrebig anvisiert wird, egal ob gefährliche Strassen den Weg versperren und manch einer das Leben lässt.
Das Erdkrötenmännchen ist auch ein fauler Kerl, denn begegnet ihm auf dem Weg ein Weibchen, umklammert er es und lässt sich gemütlich zum Laichplatz tragen. Manchmal umklammern auch mehrere Männchen ein Weibchen und es entsteht ein ganzes Krötenknäuel. Für das Weibchen kann dies lebensgefährlich werden und bis zum Tode führen.



Die Laichplätze werden unterschiedlich gewählt. Frösche legen bevorzugt ganze Laichballen in stehendem oder langsam fliessendem Gewässer. Kröten legen zwischen Pflanzenstängeln ganze Laichschnüre ab. Nun ist der Nachwuchs sich selbst überlassen, denn Amphibien kümmern sich nicht weiter darum. Nur das Männchen der Geburtshelferkröte trägt den Laich an den Hinterbeinen mit
sich, bis die Larven schlupfreif sind. Nach etwa zwei Wochen, sofern Fressfeinde wie der Bergmolch die Eier nicht schon gefressen haben, schlüpfen die Larven, die Kaulquappen. Mit dem starken Ruderschwanz können sich die Larven flink fortbewegen, und mit etwas Glück entkommen sie den räuberischen Fischarten, dem Gelbbrandkäfer oder der Libellenlarve.


Langsam treten die Hinterbeine und später die Vorderbeine aus dem Körper hervor und es entwickelt sich das Froschmaul. Mit der äusserlichen Veränderung, beginnt auch die innere. Am Ende dieser Umwandlungszeit, der Metamorphose, wird von Kiemen- auf die Lungenatmung umgestellt, und der Magen wird vollständig ausgebildet, um tierische Nahrung aufnehmen zu können.
Jetzt ist es so weit, nach zwei bis drei Monaten verlassen die erst knapp einen Zentimeter grossen Jungtiere das Gewässer und treten zu Hunderten oder Tausenden den Weg ins Sommerquartier an. Tagsüber verkriechen sich die Frösche und Kröten in feuchten Verstecken, und mit Anbruch des Abends wird nach Insekten, Spinnen, Würmern und Asseln gesucht. Auch hier lauern Gefahren, und ein Grossteil der Jungtiere, aber auch der Älteren fallen Graureiher, Eule, Greifvögeln, Fuchs, Dachs etc. zum Opfer.


Frösche sind im Sommer und Winter an Land
Die Sommerquartiere sind sehr vielfältig, Hauptsache, es ist ausreichend feucht und es gibt gute Versteckmöglichkeiten. Dies kann sowohl eine Hecke oder auch ein Ast- oder Laubhaufen im Garten sein. Auch für den Winter sind die Anforderungen unterschiedlich. Die einen suchen ein Erdloch oder eine Höhle, verkriechen sich unter Laub, Moos oder Steinen, um dort die Winterruhe zu verbringen. Andere kehren im Spätherbst zu den Laichgewässern zurück, um dort an einer sauerstoffreichen Stelle zu überwintern. Auf dieser Wanderung Ende Oktober, Anfang November sind sie wieder zahlreichen
Gefahren ausgesetzt.
Im Winterquartier werden die Atmung und alle Körperfunktionen reduziert. Die Tiere sind dann eher schwerfällig und wirken träge. Auch bei Temperaturen von wenigen Graden können sie sich bewegen und nehmen die Umgebung wahr. Sie nehmen dann aber keine Nahrung auf, sondern zehren von den Fettreserven, bis es wieder Frühling wird. Dann beginnt die Wanderung aufs Neue.

Frösche können hüpfen, Kröten können sich nur laufend bewegen
Frösche und Kröten fühlen sich warm, mit rauer Oberfläche und ganz leicht an, so beschreiben es viele, die einen Frosch oder eine Kröte auf der Hand hatten. Und das kann vielfach nötig sein, gerade im Frühling, wenn die Tiere auf Wanderschaft sind und Strassen oder andere gefährliche Stellen überqueren und wir ihnen zur Hand gehen dürfen.
Frösche sind von den Kröten teilweise schwer zu unterscheiden, rein vom Aussehen her, aber sie bewegen sich unterschiedlich. Kröten haben eher kurze Hinterbeine und bewegen sich daher laufend, sprich, sie hüpfen nicht. Frösche hingehen haben lange, muskulöse Hinterbeine und können sich mit diesen geschickt fortbewegen, sprich, sie hüpfen mehr. Der Springfrosch zum Beispiel kann bis zu zwei Meter weit und einen Meter hoch springen. Das ist beachtlich, denn ist immerhin das 25-Fache seiner Körperlänge. Da sehen unsere Weitspringer alt aus.
Übrigens sollte man sich, nachdem man einen Forsch oder Kröte in den Händen hielt, nicht in die Augen fassen, denn dies kann stark brennen. Der Grund: Nebst vielen Schleimdrüsen gibt es auch weniger häufige Giftdrüsen,die ein giftiges Sekret produzieren, um Fressfeinde abzuwehren. Diese schützen die Haut aber auch vor Infektionen und Pilzbefall. Deshalb immer zuerst die Hände waschen.
Weitere Wildtier-Themen die Sie interessieren könnten:
Tag- und Nachtfalter - schönes Flattern unserer Schmetterlinge
Der Goldschakal in der Schweiz ist heimlich auf dem Vormarsch
NATURZYT Ausgabe März 2022, Text Michael Knaus, Fotos AdobeStock